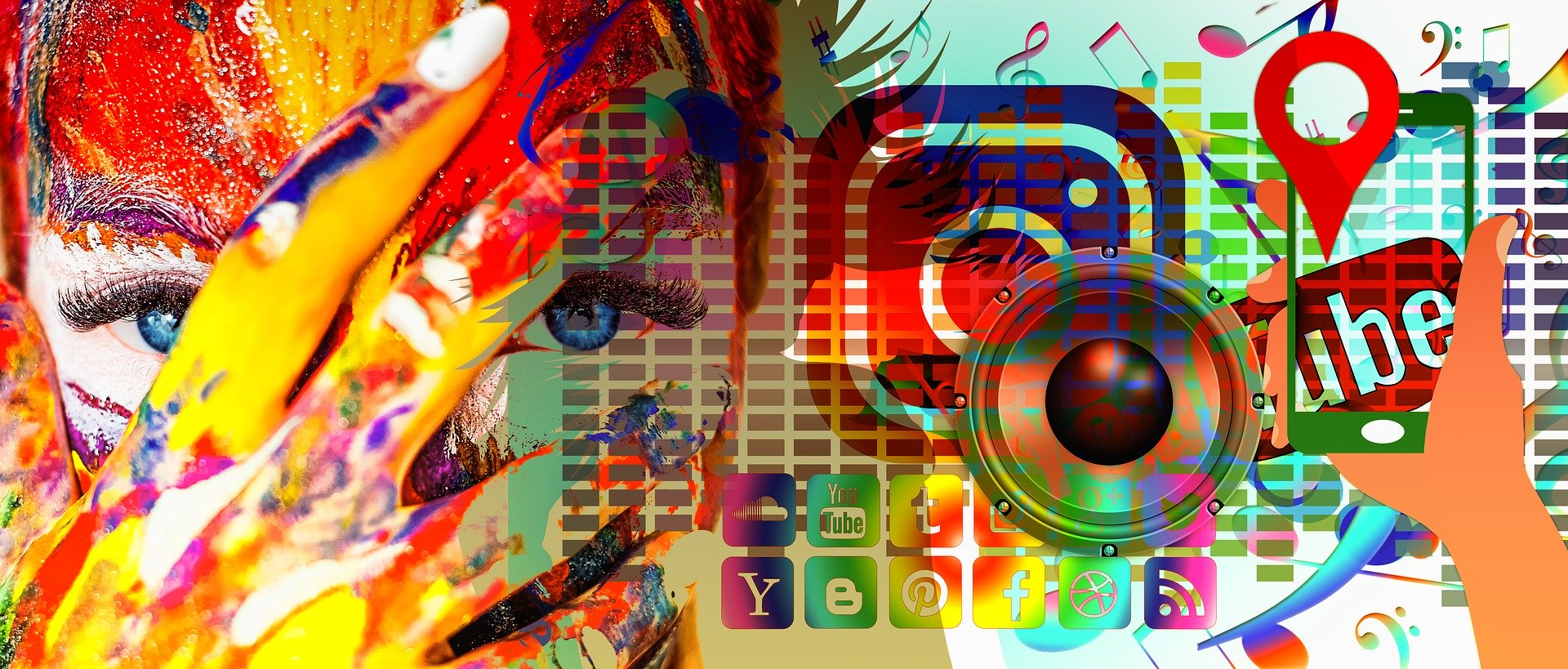Zur (schwierigen) Regulierung von Social Media
Von Christian Berger, Elisabeth Lechner und Johannes Warter
Die mediale Veränderung von Handschriften zum Buchdruck war wohl ähnlich tiefgreifend wie jene vom Buchdruck zur Digitalisierung. Mit Erfindung des Buchdrucks konnte man Bücher plötzlich schnell, günstig und massenhaft produzieren. Mit dieser neuen Technik wurden aber freilich nicht nur ehrenwerte Ziele verfolgt. Schnell dienten Flugschriften auch der Propaganda oder Agitation. Damit wuchs nicht nur das Wissen, sondern auch die Verunsicherung. Und die soziale Spaltung.
Auch soziale Medien potenzieren die gesellschaftlichen Widersprüche, die mit medialer Vervielfältigung einhergehen. Digitale Plattformen geben vielen Anlass zu Pessimismus. Autokratische Beeinflussung von Wahlprozessen geben ebenso Grund zur Sorge wie medienrechtliche Grundfragen, datenschutzrechtliche Versäumnisse und algorithmische Diskriminierung großer Plattformen mit faktischer Monopolstellung. Was tun, um alte Probleme auf neuen Plattformen so zu regulieren, dass deren demokratisches Potenzial entfaltet, digitale Teilhabe Realität und Risiken vermindert werden können?
Macht über Inhalte
Heute bereiten Hate Speech und die Verbreitung von Verschwörungstheorien in immer weiteren Teilen der Gesellschaft vielen Kopfzerbrechen. Dies ist im Rahmen derartiger Umwälzungen aber nicht neu. Schon immer war die herrschende Elite bestrebt, die Macht über Inhalte zurückzuerlangen. Während vor Erfindung des Buchdrucks (zu Zeiten der Kopisten und Skriptorien) eine inhaltliche Kontrolle aufgrund der geringeren Anzahl von Texten wesentlich einfacher war und Schriften ohnehin überwiegend im klösterlichen Umfeld entstanden, wurde dies mit Erfindung des Buchdrucks plötzlich anders. Von den Machthabenden – insbesondere der katholischen Kirche des 16. Jahrhunderts – wurden zwar die Vorteile des Buchdrucks als Medium des Wissenstransfers erkannt, sie sahen das Buch aber auch als Gefahr in Form eines Überträgers von Ideen, die den bestehenden Interessen der Mächtigen zuwiderlaufen konnten.
Zentrales Instrument zur Wiedererlangung der Macht war die Zensur. Teilweise musste der Druck eines Buches im Vorhinein explizit erlaubt werden (Vorzensur), teilweise wurden bereits gedruckte Bücher verboten (Nachzensur), etwa im berühmten Index librorum prohibitorum (die letzte amtliche Ausgabe datiert aus dem Jahr 1962!). Werke wurden allerdings nicht nur verboten, sondern deren Inhalte oder gar ganze Bücher gleich gänzlich vernichtet. Neben der Kirche hatten aber auch die Reichsstände sowie der Kaiser ein Recht zur Zensur und verfolgten damit ihre eigenen Interessen.
Über das Mittel der Zensur wurden aber auch andere, begleitende Maßnahmen erlassen. So wurde einerseits mittels Anreizsystemen versucht, die Inhalte zu steuern. Dies geschah durch sogenannte Privilegien. Wer seine Bücher vor Nachdrucken (Raubkopien) geschützt wissen wollte, musste bei einer politischen Gewalt um Schutz ansuchen. Der Schutz sah dabei so aus, dass privilegierte Personen im Falle eines Nachdrucks die unautorisiert entstandenen Exemplare einziehen und Schadenersatz von deren Produzenten verlangen konnten. Freilich wurde dieses Privileg nur genehmen Inhalten und Personen erteilt.
Bis in das 18. Jahrhundert ist das Zensurnetz so weit gediehen, dass häufig ohne Druckgenehmigung der Zensur kein Privileg mehr erteilt wurde. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde ein Regelwerk geschaffen, das die bis dahin vorherrschende Methode der Zensur von Inhalten beenden sollte und gleichermaßen die für die Gesellschaft wichtigen Funktionen von Massenmedien – vor allem die Freiheit der Informationsbeschaffung und -verbreitung – sicherstellen sollte. Leitprinzipien dieser Regelungen waren Pressefreiheit und Medienregulierung.
Pressefreiheit, Medienrecht und Kartellverbot
Die Pressefreiheit erfüllt – in der Theorie – eine wichtige Funktion für die liberale und pluralistische Demokratie, da sie zu einer offenen geistigen Auseinandersetzung und dem Meinungsbildungsprozess in der Bevölkerung beiträgt. Pressefreiheit sichert den Medienunternehmen das Recht, Informationen zu veröffentlichen, und gewährt dafür eine Reihe von Privilegien (z. B. Schutz vor Zensur und Verhaftung, privilegierter Zugang zu Informationen und vor allem der Schutz des Redaktionsgeheimnisses).
Doch Pressefreiheit verpflichtet auch: Denn Medienunternehmen müssen Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen und im Zweifelsfall den Wahrheitsbeweis antreten können. Sie dürfen nicht die Privatsphäre von Personen verletzen und müssen stets beide Parteien befragen und ihnen genügend Zeit einräumen, ihre Sichtweise darzulegen. Sie dürfen keine Hetze verbreiten und keine Werke stehlen. Diese Verantwortung liegt in den Händen der Medienunternehmen selbst. Versagen sie dabei, können die Geschädigten den Medienbetrieb klagen.
Um eine möglichst große Medienvielfalt sicherzustellen, verbietet das Kartellrecht Verhaltensweisen, welche eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Marktes bezwecken oder bewirken. Der Erhalt der Medienvielfalt war in der Vergangenheit aber besonders bei großen Medienumbrüchen, wie der Erfindung des Radios oder des Fernsehens, schwierig, da hier meist sehr hohe Investitionen nötig waren, was zwangsläufig zu einer Monopolisierung dieser Massenmedien führte bzw. Konzentration von Medienkapital bewirkte.
Aufgrund der Auswirkungen auf die Gesellschaft und der damit einhergehenden Macht, wollte man dieses Instrument weder einzelnen Firmen noch dem Staat überlassen. In Europa setzte sich deshalb das System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch: Rundfunkanstalten erhielten vom Staat einen Grundversorgungsauftrag für Informationen. Zugleich waren sie aber nicht dem Staat unterstellt.
Social Media als neue Medienunternehmen
Ausgangslage der Regulierungsproblematik rund um digitale Plattformen ist nun, dass sich soziale Medien nicht als Medienunternehmen verstanden wissen wollen; sie sehen sich als reine Plattformen, die eine digitale Basis zur Verfügung stellen und mit Informationen oder Vernetzungsdienstleistungen handeln. Sie liefern die Technologie – der Inhalt kommt von User*innen, die jeweils selbst dafür verantwortlich sind.
Inwieweit diese Positionierung zutreffend ist, ist Dreh- und Angelpunkt der Diskussion, zumal soziale Medien de facto weit mehr als bloße digitale Flächen sind. Sie sind vielmehr Herausgeberinnen ganz eigener Medienprodukte (Newsfeed, Listings etc.). Damit verbunden ist auch die Frage, ob Unternehmen wie Facebook/Instagram, Twitter und TikTok rassistische, homophobe oder schlichtweg falsche Beiträge, Betrugsversuche und politische Lügen löschen oder zumindest kennzeichnen müssen. Plattformkonzerne haben als private Akteure überdies so viel (Daten-)Macht erlangt, dass sie eine marktbeherrschende bzw. eine De-facto-Monopolstellung innehaben; sie erlassen eigene Richtlinien, setzen ihre Betriebssysteme als Standards durch, um Innovationen gezielt zu verhindern bzw. zu steuern, schaffen faktische Markteintrittsbarrieren und bauen oder kaufen Leitungsnetze, haben also erhebliche ökonomische, infrastrukturelle und Regeln erlassende Macht. Vom allgemeinen Wettbewerbs- bzw. vom Kartellrecht sind sie dennoch aufgrund des Problems der schwierigen Marktabgrenzung der digitalen Wirtschaft (noch) nicht adäquat erfasst. In diesem Diskussions- und Regulierungsfindungsprozess finden wir uns heute auch bei sozialen Medien wieder. Mit etwas Glück brauchen wir aber keine 550 Jahre, um mit Digitalisierung gesellschaftlich und rechtspolitisch klarzukommen.
Plattformen demokratisieren
Die größten Plattformen Facebook/Instagram, Twitter und TikTok haben maximale Daten- und Profitakquise zum Ziel, nicht – wie ursprünglich von den cyberfeministischen Tech-Optimist*innen der 90er-Jahre gefordert – einen möglichst transparenten, egalitären Zugang zum Internet für alle. Nick Srnicek spricht deswegen – wie andere Expert*innen auch – von Plattformkapitalismus als System: Nutzer*innendaten, ihre Vorlieben und Konsumentscheidungen werden gesammelt und an die höchstbietenden Werber verkauft. Je mehr Nutzer*innen bei einer Plattform gemeldet sind, desto profitabler: Netzwerkeffekte, die oft zu Monopolstellungen führen.
Viel beachtet ist die Systemkritik von Shoshana Zuboff, die in ihrem jüngsten Monumentalwerk das Zeitalter des Überwachungskapitalismus ausruft. Menschliche Erfahrung wird zum Rohmaterial und, übersetzt in Verhaltensdaten, zur wertvollen Ware. Auf Basis dieser Daten ergeben sich, was Zuboff „Vorhersageprodukte“ nennt, die auf verhaltensbezogenen Zukunftsmärkten gehandelt werden. Zuboffs Abhandlung endet in einer düsteren Zukunftsprognose – kompletter Kontrollverlust über unsere Daten, Persönlichkeitsrechte eingeschränkt oder gänzlich dahin, Dauerüberwachung der Normalzustand.
Jeremy Gilbert teilt die Kritik an der uneingeschränkten Datenmacht der Silicon Valley Monopolist*innen, zieht aber gänzlich andere Schlüsse aus Zuboffs Bestandsaufnahme. Den Widerstand gegenüber Plattformen auf Individuen abzuwälzen, etwa indem man zum Boykott der Netzwerke oder mehr „Vorsicht“ im Umgang mit Persönlichkeitsdaten aufruft, werde nicht funktionieren. Immerhin sind die digitalen Dienstleistungen, die sie anbieten, für viele mittlerweile unverzichtbar geworden. Vielmehr brauche es (über)staatliche Regulierungsmaßnahmen von „Big Tech“, die auf die soziale, vernetzte Natur von Menschen Rücksicht nehmen und allen ermöglichen, digital teilzuhaben. Warum sollten diese Netzwerke von Verwertungsinteressen gelenkt werden, während sie als öffentliche Plätze eine gesellschaftlich integrative Funktion erfüllen und als infrastrukturelles, mediales Allgemeingut auch unter demokratischer Kontrolle zum Nutzen aller geführt werden könnten? Das wäre der zentrale Ausgangspunkt progressiver Digitalisierungspolitik, die Grundlage für Datensouveränität, Medienpluralität, Daseinsfürsorge, digitale Demokratie und gerechte Formen des Arbeitens und Lebens der Zukunft.