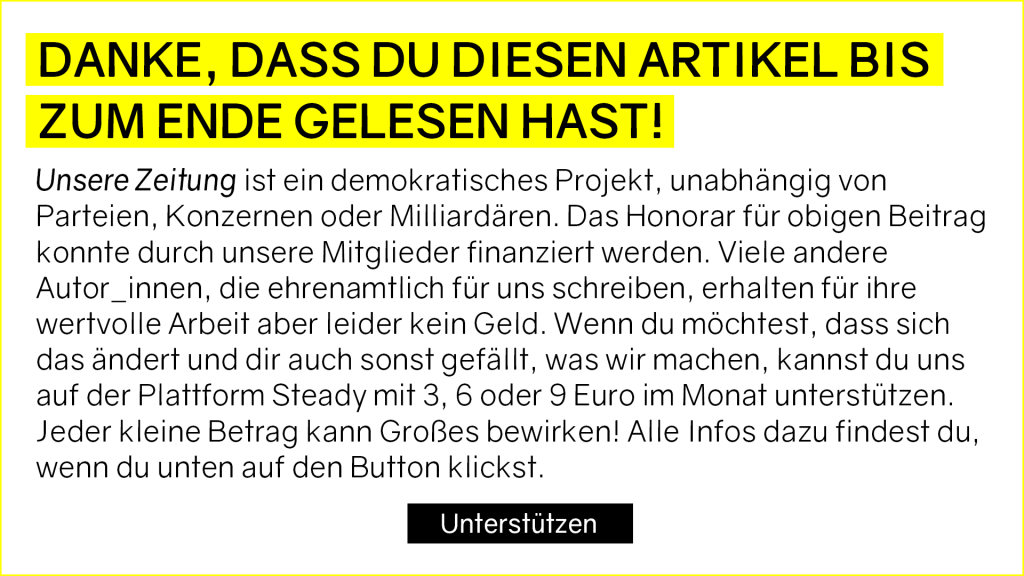Der Verfassungsgerichtshof wies vergangene Woche die erste österreichische Klimaklage zurück. Über 8.000 Menschen hatten sich der von Greenpeace getragenen Sammelklage angeschlossen, darunter auch ich. Diese unkonventionelle demokratische Beteiligungsform der „strategischen Prozessführung“ stellt einen Versuch dar, die Politik zu mehr Klimaschutz zu drängen.
Von Tamara Ehs

„Fliegen wird steuerlich belohnt, Bahnfahren bestraft. Klage mit uns gegen dieses Unrecht!“ rief Greenpeace vor rund einem Jahr auf, sich der Sammelklage – einer Bündelung aus Individualanträgen – vor dem Verfassungsgerichtshof (VfGH) anzuschließen. Geklagt werden sollte gegen klimaschädliche Gesetzgebung, konkret gegen die Kerosinsteuerbefreiung, im Grunde aber für ein „Recht auf Zukunft“, so auch die Parole. Ich schloss mich damals der Klage an, so wie ich auch das Klimavolksbegehren unterzeichnete und mich für Klimabürgerräte einsetze: in der Hoffnung, dass die Ausschöpfung aller demokratisch zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu einer ambitionierteren Klimapolitik verhelfen möge.
Nun gab der VfGH bekannt, dass er die Klimaklage nicht zulässt, weil keine Antragsberechtigung gegeben sei. Da wir Kläger_innen angegeben hatten, mit den ÖBB zu reisen und hierbei steuerlich benachteiligt zu sein, wären wir nicht berechtigt, eine Steuerbefreiung für den Flugverkehr zu rügen, den wir ja gar nicht benützten. Michaela Krömer, unsere Rechtsvertreterin, nannte den Formalismus des Gerichts in ihrer ersten Stellungnahme „mutlos und konservativ“. Der VfGH hätte wenigstens das Rechtsschutzdefizit aufzeigen können, um eine Diskussion über Reformbedarf zu starten. Der Richter Oliver Scheiber bestätigte Krömers Einschätzung, sah in ihrer Pionierarbeit zugleich ein Fundament für weitere juristische Anstrengungen und bedauerte, dass der VfGH „die international viel weiter fortgeschrittene rechtliche Auseinandersetzung mit Klima- und Umweltfragen nicht aufzugreifen vermag.“
Tatsächlich stellen Klimaklagen eine weltweit boomende Beteiligungsform dar: Mittels der sogenannten „strategischen Prozessführung“ oder „Rechtsmobilisierung“ bringen Einzelpersonen, Interessensvertretungen oder NGOs Klagen mit dem Ziel ein, umstrittene Gesetze in einem Gerichtsverfahren zu Fall zu bringen beziehungsweise die Politik in einer bestimmten Frage zu verändern und weiterzuentwickeln. Die Intention jener Klagen geht damit über den eigentlichen Streitgegenstand hinaus und funktioniert als rechtspolitischer Partizipationskanal, um grundlegende gesellschaftspolitische Veränderungen zu erreichen.
Klimaklagen gibt es bereits seit den 1990er Jahren, aber erst in jüngster Zeit kommen sie weltweit zum Einsatz, um die Politik zu mehr Klimaschutz zu drängen. Das Grantham Forschungsinstitut der London School of Economics unterhält eine laufend aktualisierte Datenbank zum Thema „Climate litigation“. Mit heutigem Datum finden sich dort 411 Einträge. Davon kommen zwar drei Viertel aus den USA, doch andere Staaten holen auf. Als wegweisend gilt die 2015 vom Lahore-Höchstgericht verkündete Entscheidung, dass die Republik Pakistan es verabsäume, ihre eigenen Klimagesetze umsetzen, wodurch sie „die zu schützenden Grundrechte der Bürger verletzt.“ Das Gericht vermisste politische Antworten auf ein „sich herausbildendes Muster von schweren Überschwemmungen und Dürren.“
Es war das erste Urteil, das die „attribution science“ (Zuordnungswissenschaft) in seine rechtlichen Erwägungen einbezog, also extreme Wetterereignisse einem von Menschen verursachten Klimawandel zuzuordnen. Denn erst mit der Zuschreibung können Rechte gegenüber Angeklagten wie Regierungen oder den „Carbon Majors“ – das sind die größten Öl-, Gas- und Kohlekonzerne – geltend gemacht werden.
Im Zentrum der Klimaklagen steht die Anerkennung des Menschenrechts auf ein intaktes, stabiles und eben nicht lebensfeindliches Klimasystem. Bei der österreichischen Klimaklage ging es um Grundrechte (wie das Recht auf Leben, Gesundheit und unversehrtes Eigentum), die zu schützen sich die Republik unter anderem auch im Rahmen der Europäischen Menschenrechtskonvention verpflichtet hat. Wir folgte damit nationalstaatlichen Klagen wie beispielsweise von niederländischen Umweltschützer_innen, die mit Hilfe der NGO „Urgenda“ ihre Regierung auf Grundlage der in der Verfassung verankerten Fürsorgepflicht, das Land bewohnbar zu halten, verklagt hatten. Das Gericht im Haag gab ihnen Recht und verpflichtete die Niederlande, Treibhausgasemissionen drastisch zu reduzieren. Dass die Regierung dagegen Rechtsmittel einlegte und trotz Urteilsbestätigung noch immer säumig ist, mindert allerdings die Freude über den gewonnenen Rechtsstreit.
Tamara Ehs ist Wissensarbeiterin für Demokratie und politische Bildung. Dabei berät sie auch Städte und Gemeinden in partizipativen und konsultativen Prozessen. Sie ist Trägerin des Wissenschaftspreises des österreichischen Parlaments. Soeben ist ihr neuestes Buch „Krisendemokratie“ (Wien: Mandelbaum Verlag 2020) erschienen.
Titelbild: Unsere Zeitung/Moritz Ettlinger